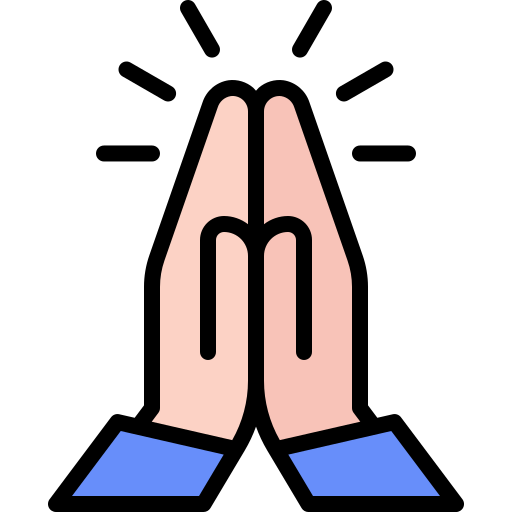Unser Dorf liegt eingebettet in einem gr�nen Tal, umgeben von dichten W�ldern, die wie ein lebendiger Wall um uns stehen. Die H�user sind aus grobem Stein und dunklem Holz gebaut, mit D�chern aus Strohb�ndeln, die in der Sonne golden schimmerten. Zwischen den Geb�uden schl�ngeln sich schmale, mit Kieselsteinen bedeckte Wege, die vom t�glichen Gebrauch glatt getreten werden. Ein kleiner Bach flie�t quer durch das Dorf, sein Pl�tschern war das st�ndige Hintergrundlied unseres Alltags.
Die Felder, die das Dorf umgaben, waren in der warmen Jahreszeit ein Flickenteppich aus sattem Gr�n und goldenen �hren. K�he und Schafe weideten auf den saftigen Wiesen, ihre Glocken bimmelten leise im Wind. Der
Duft von frisch gebackenem Brot und feuchtem Moos liegt nahezu immer in der
Luft. Es ist ein friedlicher Ort, idyllisch und doch haftet ihm etwas
Geheimnisvolles an - eine Art unausgesprochene Vorsicht, die wir alle tief in uns tragen.
In der Mitte des Dorfes steht der Marktplatz mit einem alten Brunnen aus verwittertem Stein. Um ihn herum gruppierten sich die wichtigsten Geb�ude.
Die Schenke mit ihren knarrenden Fenstern, die Schmiede, wo der Klang von
Hammer und Amboss durch die Stra�en hallt und ein gro�es
Versammlungshaus, wo das Dorf f�r wichtige Dinge zusammenfindet.
Die Menschen hier leben einfach, aber zufrieden. Wir kennen unterereinander jeden beim Namen, halfen einander bei t�glichen Arbeiten oder wenn ein Dach nach einem Sturm geflickt werden musste. Es ist ein Ort der Gemeinschaft, der Geborgenheit - bis der Vollmond �ber den Wipfeln der B�ume aufgeht.
Jedes Mal, wenn der Mond rund und silbern �ber dem Dorf thront, ver�ndert sich die Stimmung. T�ren, die sonst immer offen stehen, werden fest verriegelt, Balken quer vor die Eing�nge geschoben. Die Fensterl�den, oft nur lose an den H�usern befestigt, werden mit schweren Eisenharken verschlossen. Kein Licht durfte nach drau�en dringen. Selbst der Hund der Schenke, der sonst bellend durch die Stra�en streifte, wurde ins Haus geholt. Niemand sprach dar�ber, aber jeder wusste, warum.
In der Dunkelheit, wenn der Mond seine kalten Strahlen auf die D�cher wirft, wurden die Stra�en leer. Der Wind tr�gt seltsame Ger�usche aus dem Wald hin�ber ins Dorf. Niemand traute sich, hinzusehen. Das Dorf lauschte nur, mit angehaltenem Atem, bis der erste Hahnenschrei die Morgend�mmerung ank�ndigte.
So leben wir, zwischen Idylle und einer Furcht, die so alt ist, wie das Dorf selbst. Manche sagen, es seien nur Geschichten, M�rchen, die man Kindern erz�hlt, um sie vor der Dunkelheit zu warnen. Aber die Alten sch�tteln nur die K�pfe, ihre Augen werden dabei dunkel und still. ?Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als man mit blo�em Auge sehen kann.", pflegte meine Mutter zu sagen. Und auch wenn sie nicht wirklich meine Mutter war, war ich mir jedes Mal, wenn die Nacht hereinbrach sicher, dass sie recht damit hatte.
Obwohl ich in diesem Dorf aufgewachsen war, hatte ich mich nie wirklich als ein Teil davon gef�hlt. Es war, als ob zwischen mir und den anderen eine unsichtbare Wand stand, durch die ich sie sehen, h�ren und auch anl�cheln konnte, die mich aber gleichzeitig immer ein wenig auf Abstand h�lt. Jeder kennt mich und ich kenne jeden. Wir gr��en uns freundlich, ich helfe oft auf den Feldern oder brachte den �ltesten Wasser, aber echte Freunde hatte ich nie. Die anderen Jugendlichen in meinem Alter begegnen mir mit einer h�flichen Freundlichkeit, die mich mehr verletzte, als wenn sie mich offen abgelehnt h�tten. Ihr L�cheln ist nie ganz echt, ihre Worte nie mehr als fl�chtig. Es war, als w�re ich f�r sie eine Randnotiz, etwas, das sie duldeten, aber nie ganz akzeptierten.
Ich verstehe, warum es so war. Ich war nicht wie sie. Sie alle waren im Dorf geboren worden, ihre Wurzeln tief im Boden, genauso wie die alten Eichen, die um unser Dorf wuchsen. Meine Mutter - oder die Frau, die ich immer als meine Mutter kannte - hatte mich einst am Waldrand gefunden. Ich war noch ein S�ugling gewesen, nackt, in T�cher gewickelt, die l�ngst verblichen und zerfetzt waren. Niemand wusste, wer mich dorthin gebracht hatte, oder warum. Manche im Dorf fl�sterten hinter vorgehaltener Hand, dass ich ein ungewolltes
Kind sei, ein Balg, das im Wald sterben sollte. Andere meinten, ich sei ein Wechselbalg, von Feen oder Wesen aus den dunkelsten Tiefen der W�lder zur�ckgelassen. Solche Geschichten flogen wie Schatten hinter meinem R�cken, leise aber sp�rbar.
Meine Mutter hatte mich trotzdem aufgenommen, ohne zu z�gern. Sie erz�hlte mir immer, dass sie mich f�r ein Geschenk hielt - dass der Wald, der uns ern�hrte, mich ihr geschenkt hatte. Sie liebt mich, das wei� ich. Aber selbst sie kann nicht verhindern, dass die anderen Dorfbewohner immer einen Schritt Abstand halten. Sie sehen mich an, als k�nnte in meinen Augen eine Wahrheit lauern, die sie nicht aussprechen wollen.
Auch wenn ich sie mag und mich nach N�he sehne, sp�re ich, dass sie mich nie ganz akzeptieren w�rden. Besonders die anderen Jugendlichen. W�hrend sie ihre Abende lachend und tuschelnd am Bach verbrachten, w�hrend sie sich kleine Mutproben gaben oder einander Geschichten erz�hlten, sa� ich oft allein an unserem kleinen Haus, lauschte den Ger�uschen der Nacht oder strich �ber die Seiten eines Buches, das mir meine Mutter geschenkt hatte. Sie luden mich manchmal ein, aber ich wusste, dass es nur aus H�flichkeit geschah. Ihre Blicke, wenn sie dachten, ich s�he sie nicht, verrieten ihre wahren Gedanken. Es war einfacher, den Abstand zu wahren, als diese falschen Freundlichkeiten zu ertragen.
Manchmal frage ich mich, ob es anders w�re, wenn ich w�sste wer ich wirklich bin. Warum ich an den Waldrand abgelegt worden war und von wem. Doch die Antwort ist nach wie vor, vor mir verborgen, fast wie fest von Nebel umh�llt.
Vielleicht war das der Grund, warum ich mich zum Wald hingezogen f�hlte. W�hrend die anderen D�rfler ihn mieden und nur betraten, wer musste, fand ich dort eine seltsame Art von Frieden. Es ist der einzige Ort, an dem ich mich nicht wie eine Fremde empfinde. Unter den alten B�umen, wo die Luft nach Erde und Moos riecht, war ich nicht mehr ?das M�dchen, das man gefunden hatte". Dort war ich einfach nur ich.
Mit den Jahren ver�nderte sich jedoch mein Leben im Dorf. Als Kind war ich einfach das fremde M�dchen, das man h�flich ignorierte. Doch je �lter ich wurde, desto mehr sp�rte ich, dass sich etwas ver�nderte - nicht in mir, sondern in den anderen. Die M�dchen im Dorf, mit denen ich fr�her gelegentlich sprach oder gemeinsam die K�he auf die Weide brachte, wurden abweisend. Ihre Blicke waren pl�tzlich kalt, ihre Worte kurz. Sie lachten miteinander, warfen mir aber nur knappe, misstrauische Blicke zu, wenn sie dachten, ich bemerke es nicht. Ich habe versucht, mich davon nicht beirren zu lassen, aber es tat weh. Ich f�hlte mich allein, ausgeschlossen, wie ein St�renfried in einer Welt, die mich nie wirklich aufnehmen wollte.
Mit den Jungen war es noch schlimmer. Anfangs war es nur ein Gef�hl, ein Hauch von Unbehagen, wenn ihre Augen l�nger auf mir ruhten, als es n�tig gewesen ist. Ihre Blicke hatten nichts Freundliches, nichts Spielerisches. Sie musterten mich, als w�re ich ein R�tsel, das sie unbedingt l�sen wollten - oder die Beute, die sie jagen konnten. Anfangs waren es nur zuf�llige Gesten: eine Hand, die meinen Arm streifte, ein Finger, der scheinbar aus Versehen �ber meinen R�cken strich. Es waren Dinge, die leicht als Missverst�ndnisse abgetan werden konnten, die vielleicht sogar unbeabsichtigt sein konnten. Doch ich wusste es nach einer Weile besser, es waren keine Zuf�lle.
Je mehr ich versuchte, mich diesen Blicken und Gesten zu entziehen, desto hartn�ckiger wurden sie. Die Jungen suchten immer wieder meine N�he, fingen an, zweideutige Bemerkungen zu machen, die mir die R�te ins Gesicht trieben, aber nicht vor Verlegenheit, sondern vor Scham und Wut gleicherma�en. Ihre Andeutungen wurden direkter, ihre Stimmen fordernder. Ich wies sie zur�ck, immer entschiedener, doch es was als w�rde sie das nicht interessieren. Ihr Gel�chter hallte mir im Kopf nach, ihre Worte brannten sich in mein Ged�chtnis ein.
Was mich noch mehr beunruhigte, war, dass es nicht bei den Jungen blieb. Die �lteren M�nner des Dorfes schienen es besser zu verbergen, aber ich bemerkte ihre Blicke trotzdem. Sie waren subtiler, weniger offensichtlich, aber in manchen Augen lag ein Ausdruck, der mir das Blut in den Adern gefrieren lie�. Ich f�hlte mich wie ein Tier, das in einem K�fig beobachtet wird, jede Bewegung registriert, jedes Zucken interpretiert. Es war erdr�ckend und ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Ich habe mit niemandem dar�ber gesprochen. Nicht mit meiner Mutter, nicht mit den �ltesten. Was h�tte ich auch sagen sollen? Dass ich Angst hatte vor den Blicken, vor den Andeutungen? Dass ich mich immer unwohler f�hlte? Ich wusste, dass mir niemand glauben w�rde. Und dann kam der Moment, in dem sie ihre Zur�ckhaltung endg�ltig ablegten.
Die Ber�hrungen wurden fordernder, ihre Worte direkter. Manche Jungen versuchten sogar, mich in die Enge zu treiben, wenn ich allein war. Ich entkam immer, fand immer einen Weg, mich aus der Situation zu winden, aber es wurde immer schwieriger. Und dann begann das Gerede. Die anderen Dorfbewohner - Frauen, M�nner, selbst die �ltesten- fl�sterten hinter meinem R�cken. Ich h�rte es, wenn ich an ihnen vorbeiging, wie ihre Stimmen abfielen, wie die Worte ?Verf�hrung" und ?Hexerei" laut genug waren, dass ich sie verstehen konnte. Sie sagten, ich h�tte die Jungen des Dorfes verhext, ihre K�pfe verdreht und sogar die M�nner, die alt genug waren, um es besser zu wissen.
Manche behaupteten, es sei ein Fluch, den ich aus dem Walt mitgebracht hatte, als das Baby, das man am Waldrand gefunden hatte. Andere Sprachen davon, dass ich einen Verf�hrungszauber wirken w�rde, wie eine Hexe aus den Geschichten, die sie sich abends am Feuer erz�hlten. Ich h�tte lachen k�nnen, so eine absurde Vorstellung. Aber ich konnte nicht lachen. Die K�lte in ihren Augen, das Unbehagen, das in der Luft lag, war zu greifbar. Ich war keine Hexe, keine Zauberin. Ich war nur ein M�dchen, das nie dazugeh�rte und jetzt langsam zur Zielscheibe wurde.
Der Vollmond steht fast greifbar am Himmel, hell und kalt wie ein einsames Auge, das auf uns alle herabblickt. Die Luft ist erf�llt von der bekannten, stillen Spannung, die jede Vollmondnacht mit sich bringt. Doch diesmal ist sie anders. Schwerer. D�stere Vorahnungen liegen wie ein Schleier �ber dem Dorf, w�hrend die Fensterl�den verrammelt und die T�ren fest verschlossen werden.
Keiner spricht es aus, aber wir f�hlen es alle. Irgendetwas wird passieren.
Ich liege wach in meinem Bett, lausche dem Knarren des alten Holzes, das bei jedem Windsto� leise protestiert. Pl�tzlich durchbrechen Schreie die Stille. Ein durch Mark und Bein gehender Klang, der mein Herz stillstehen l�sst. Ich springe auf, laufe zum Fenster und versuche, etwas durch die schmalen Spalten der Fensterl�den zu erkennen. Doch die Nacht ist undurchdringlich und die Schreie werden von einem abrupten Schweigen abgel�st, das noch be�ngstigender ist.
Am Morgen findet man ihn - den Jungen. Seine leblosen Augen starren in den Himmel, seine H�nde ausgestreckt, als h�tte er versucht, nach etwas zu greifen, das nicht mehr da ist. Er liegt mitten auf dem Weg, der von seinem Haus zu meinem f�hrt, mit aufgerissenem Bauch. Die Menschen haben sich um ihn versammelt, w�hrend der Schock und die Trauer �ber das Dorf hereinbricht wie eine kalte Flut. Ich sp�re ihre Blicke auf mir. Die Tuscheleien werden lauter, die Worte sch�rfer, die Anschuldigungen direkter. Sie brauchen keinen Beweis, sie haben mich. Ich bin die Au�enseiterin, das Mysterium, die Fremde. Jetzt bin ich auch noch die Schuldige f�r sie.
Die Nachricht des Vorfalls verbreitet sich schneller, als ich je f�r m�glich gehalten h�tte. Es dauert nicht lange, bis er kommt. Der Herrscher, der Mann, den wir alle nur aus Geschichten kennen. Manche nennen ihn Verwalter, andere schlicht ?den Herren". Niemand wei�, wie alt er wirklich ist oder wie viele L�ndereien er besitzt. Es wird gesagt, sein Reich sei so gro�, dass er selbst nie ganz wei� wo seine Grenzen verlaufen. Und doch ist er hier, in unserem abgelegenen Dorf, sein langer Schatten f�llt auf uns alle.
Er reitet in einer Prozession, flankiert von M�nnern in dunklen R�stungen, die kein Wort sprechen, aber allein durch ihre Anwesenheit klare Botschaften senden. Sein Pferd ist tiefschwarz, ein Wesen von majest�tischer Sch�nheit, dass die Erde unter seinen Hufen erzittern l�sst. Als er absteigt, h�llt ihn eine unnahbare Aura ein, die die Luft schwer macht. Seine Bewegungen sind ruhig, pr�zise, schnell wie ein Raubtier, das nie unn�tige Kraft verschwendet. Seine Kleidung ist schlicht, aber von so edlem Stoff, dass sie nicht aus dieser Welt zu stammen scheint.
Die Dorfbewohner sind verzweifelt. Sie flehen ihn an, uns zu besch�tzen, vor was auch immer in jener Nacht den Jungen get�tet hat. Sie bieten alles was sie haben im Austausch gegen Schutz an - Korn, Vieh, sogar ihre Ersparnisse. Doch er scheint unger�hrt. Seine dunklen Augen mustern die Menschen vor ihm ohne dass sich ein einziges Gef�hl in seinen Z�gen erkennen l�sst. Dann f�llt das Wort ?Opfer".
Die Menge dreht sich zu mir und pl�tzlich schien es, als w�rde die Welt stillstehen. Ich wei� sofort, was sie vorhaben. Ich bin das naheliegende Ziel, die einfache L�sung. Wenn sie mich opfern, k�nnen sie vielleicht ihre Ruhe zur�ckkaufen - so denken sie sich das jedenfalls. Und vielleicht haben sie ja sogar Recht. Doch anstatt mich vor Angst zu winden, habe ich das Gef�hl, dass etwas anderes in mir aufsteigt. Etwas Wildes, unbez�hmbares. Trotz. Stolz. ?Kate, sie wird unser Opfer sein. Kate ist unser Opfer an dich, oh Herr.", ert�nt die Stimme eines Mannes. Ich wei�, dass ich keine Wahl habe, dass mein Leben hier l�ngst vorbei ist. Wenn ich bleibe werde ich auf dem Scheiterhaufen enden, oder von den Blicken und H�nden der M�nner erdr�ckt. Ich habe nichts zu verlieren. Also richte ich mich auf, hebe mein Kinn und lasse keinen Funken Unsicherheit in meinen Augen aufblitzen. ?Gut", sage ich k�hl. ?Dann bin ich das
Opfer dieses Dorfes. Aber nicht, weil ihr es wollt. Sondern weil ich es w�hle."
Die Menge verstummt. Niemand hat mit meinen Worten gerechnet. Ohne zu z�gern gehe ich auf ihn zu, den Herren, der �ber mein Schicksal entscheiden wird. Seine Augen liegen auf mir, dunkel und durchdringend, als k�nnten sie bis auf den Grund meiner Seele blicken. Ich f�hle die K�lte, die von ihm ausgeht, aber auch die seltsame Macht, die ihn umgibt. Niemand versucht mich aufzuhalten. Die Dorfbewohner haben Angst, dass ich mich umentscheiden k�nnte. Doch das tue ich nicht.
Ich trete direkt vor ihn, halte seinem Blick stand, auch wenn mein Herz wie wild schl�gt. Ich wei�, dass meine Haltung das Einzige ist, was mir jetzt noch bleibt. Er sieht mich an, schweigend, forschend und absch�tzend. Dann hebt er seine Hand.
Es ist das erste Mal, dass mich jemand ber�hrt, seit die Entscheidung gefallen ist, dass ich sein Opfer sein soll. Seine Finger greifen leicht, aber bestimmt nach meinem Kinn und heben es an, so dass ich ihm direkt in die Augen schaue. Sein Blick ist kalt, fast wie der Mond selbst, aber es liegt auch etwas darin, was ich nicht deuten kann. Er studiert mein Gesicht, als w�rde er nach etwas suchen. Mein Stolz verbot es mir, auch nur zu blinzeln. Ich halte seinem Blick stand, trotzig und unbeugsam.
?Ein interessantes Opfer", entscheidet er, seine Stimme tief und unnahbar.
Dann l�sst er mich los und ich sp�re die Stellen an meinem Kinn, wo seine Finger grade noch gewesen sind, als h�tte er ein Zeichen hinterlassen. ?Sind sie zufrieden mit meinem Opfer?", ergreife ich das Wort und bemerke, wie einige Dorfbewohner sichtlich zusammenzucken bei meinen Worten.
Offenbar hatte das Opfer ihn nicht direkt anzusprechen.
?Oh ja.", ert�nt seine zufriedene Stimme und ich gehe mit erhobenen Haupt zu
den Wachen, die er mit einem Handzeichen heranwinkt.
Die Felder, die das Dorf umgaben, waren in der warmen Jahreszeit ein Flickenteppich aus sattem Gr�n und goldenen �hren. K�he und Schafe weideten auf den saftigen Wiesen, ihre Glocken bimmelten leise im Wind. Der
Duft von frisch gebackenem Brot und feuchtem Moos liegt nahezu immer in der
Luft. Es ist ein friedlicher Ort, idyllisch und doch haftet ihm etwas
Geheimnisvolles an - eine Art unausgesprochene Vorsicht, die wir alle tief in uns tragen.
In der Mitte des Dorfes steht der Marktplatz mit einem alten Brunnen aus verwittertem Stein. Um ihn herum gruppierten sich die wichtigsten Geb�ude.
Die Schenke mit ihren knarrenden Fenstern, die Schmiede, wo der Klang von
Hammer und Amboss durch die Stra�en hallt und ein gro�es
Versammlungshaus, wo das Dorf f�r wichtige Dinge zusammenfindet.
Die Menschen hier leben einfach, aber zufrieden. Wir kennen unterereinander jeden beim Namen, halfen einander bei t�glichen Arbeiten oder wenn ein Dach nach einem Sturm geflickt werden musste. Es ist ein Ort der Gemeinschaft, der Geborgenheit - bis der Vollmond �ber den Wipfeln der B�ume aufgeht.
Jedes Mal, wenn der Mond rund und silbern �ber dem Dorf thront, ver�ndert sich die Stimmung. T�ren, die sonst immer offen stehen, werden fest verriegelt, Balken quer vor die Eing�nge geschoben. Die Fensterl�den, oft nur lose an den H�usern befestigt, werden mit schweren Eisenharken verschlossen. Kein Licht durfte nach drau�en dringen. Selbst der Hund der Schenke, der sonst bellend durch die Stra�en streifte, wurde ins Haus geholt. Niemand sprach dar�ber, aber jeder wusste, warum.
In der Dunkelheit, wenn der Mond seine kalten Strahlen auf die D�cher wirft, wurden die Stra�en leer. Der Wind tr�gt seltsame Ger�usche aus dem Wald hin�ber ins Dorf. Niemand traute sich, hinzusehen. Das Dorf lauschte nur, mit angehaltenem Atem, bis der erste Hahnenschrei die Morgend�mmerung ank�ndigte.
So leben wir, zwischen Idylle und einer Furcht, die so alt ist, wie das Dorf selbst. Manche sagen, es seien nur Geschichten, M�rchen, die man Kindern erz�hlt, um sie vor der Dunkelheit zu warnen. Aber die Alten sch�tteln nur die K�pfe, ihre Augen werden dabei dunkel und still. ?Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als man mit blo�em Auge sehen kann.", pflegte meine Mutter zu sagen. Und auch wenn sie nicht wirklich meine Mutter war, war ich mir jedes Mal, wenn die Nacht hereinbrach sicher, dass sie recht damit hatte.
Obwohl ich in diesem Dorf aufgewachsen war, hatte ich mich nie wirklich als ein Teil davon gef�hlt. Es war, als ob zwischen mir und den anderen eine unsichtbare Wand stand, durch die ich sie sehen, h�ren und auch anl�cheln konnte, die mich aber gleichzeitig immer ein wenig auf Abstand h�lt. Jeder kennt mich und ich kenne jeden. Wir gr��en uns freundlich, ich helfe oft auf den Feldern oder brachte den �ltesten Wasser, aber echte Freunde hatte ich nie. Die anderen Jugendlichen in meinem Alter begegnen mir mit einer h�flichen Freundlichkeit, die mich mehr verletzte, als wenn sie mich offen abgelehnt h�tten. Ihr L�cheln ist nie ganz echt, ihre Worte nie mehr als fl�chtig. Es war, als w�re ich f�r sie eine Randnotiz, etwas, das sie duldeten, aber nie ganz akzeptierten.
Ich verstehe, warum es so war. Ich war nicht wie sie. Sie alle waren im Dorf geboren worden, ihre Wurzeln tief im Boden, genauso wie die alten Eichen, die um unser Dorf wuchsen. Meine Mutter - oder die Frau, die ich immer als meine Mutter kannte - hatte mich einst am Waldrand gefunden. Ich war noch ein S�ugling gewesen, nackt, in T�cher gewickelt, die l�ngst verblichen und zerfetzt waren. Niemand wusste, wer mich dorthin gebracht hatte, oder warum. Manche im Dorf fl�sterten hinter vorgehaltener Hand, dass ich ein ungewolltes
Kind sei, ein Balg, das im Wald sterben sollte. Andere meinten, ich sei ein Wechselbalg, von Feen oder Wesen aus den dunkelsten Tiefen der W�lder zur�ckgelassen. Solche Geschichten flogen wie Schatten hinter meinem R�cken, leise aber sp�rbar.
Meine Mutter hatte mich trotzdem aufgenommen, ohne zu z�gern. Sie erz�hlte mir immer, dass sie mich f�r ein Geschenk hielt - dass der Wald, der uns ern�hrte, mich ihr geschenkt hatte. Sie liebt mich, das wei� ich. Aber selbst sie kann nicht verhindern, dass die anderen Dorfbewohner immer einen Schritt Abstand halten. Sie sehen mich an, als k�nnte in meinen Augen eine Wahrheit lauern, die sie nicht aussprechen wollen.
Auch wenn ich sie mag und mich nach N�he sehne, sp�re ich, dass sie mich nie ganz akzeptieren w�rden. Besonders die anderen Jugendlichen. W�hrend sie ihre Abende lachend und tuschelnd am Bach verbrachten, w�hrend sie sich kleine Mutproben gaben oder einander Geschichten erz�hlten, sa� ich oft allein an unserem kleinen Haus, lauschte den Ger�uschen der Nacht oder strich �ber die Seiten eines Buches, das mir meine Mutter geschenkt hatte. Sie luden mich manchmal ein, aber ich wusste, dass es nur aus H�flichkeit geschah. Ihre Blicke, wenn sie dachten, ich s�he sie nicht, verrieten ihre wahren Gedanken. Es war einfacher, den Abstand zu wahren, als diese falschen Freundlichkeiten zu ertragen.
Manchmal frage ich mich, ob es anders w�re, wenn ich w�sste wer ich wirklich bin. Warum ich an den Waldrand abgelegt worden war und von wem. Doch die Antwort ist nach wie vor, vor mir verborgen, fast wie fest von Nebel umh�llt.
Vielleicht war das der Grund, warum ich mich zum Wald hingezogen f�hlte. W�hrend die anderen D�rfler ihn mieden und nur betraten, wer musste, fand ich dort eine seltsame Art von Frieden. Es ist der einzige Ort, an dem ich mich nicht wie eine Fremde empfinde. Unter den alten B�umen, wo die Luft nach Erde und Moos riecht, war ich nicht mehr ?das M�dchen, das man gefunden hatte". Dort war ich einfach nur ich.
Mit den Jahren ver�nderte sich jedoch mein Leben im Dorf. Als Kind war ich einfach das fremde M�dchen, das man h�flich ignorierte. Doch je �lter ich wurde, desto mehr sp�rte ich, dass sich etwas ver�nderte - nicht in mir, sondern in den anderen. Die M�dchen im Dorf, mit denen ich fr�her gelegentlich sprach oder gemeinsam die K�he auf die Weide brachte, wurden abweisend. Ihre Blicke waren pl�tzlich kalt, ihre Worte kurz. Sie lachten miteinander, warfen mir aber nur knappe, misstrauische Blicke zu, wenn sie dachten, ich bemerke es nicht. Ich habe versucht, mich davon nicht beirren zu lassen, aber es tat weh. Ich f�hlte mich allein, ausgeschlossen, wie ein St�renfried in einer Welt, die mich nie wirklich aufnehmen wollte.
Mit den Jungen war es noch schlimmer. Anfangs war es nur ein Gef�hl, ein Hauch von Unbehagen, wenn ihre Augen l�nger auf mir ruhten, als es n�tig gewesen ist. Ihre Blicke hatten nichts Freundliches, nichts Spielerisches. Sie musterten mich, als w�re ich ein R�tsel, das sie unbedingt l�sen wollten - oder die Beute, die sie jagen konnten. Anfangs waren es nur zuf�llige Gesten: eine Hand, die meinen Arm streifte, ein Finger, der scheinbar aus Versehen �ber meinen R�cken strich. Es waren Dinge, die leicht als Missverst�ndnisse abgetan werden konnten, die vielleicht sogar unbeabsichtigt sein konnten. Doch ich wusste es nach einer Weile besser, es waren keine Zuf�lle.
Je mehr ich versuchte, mich diesen Blicken und Gesten zu entziehen, desto hartn�ckiger wurden sie. Die Jungen suchten immer wieder meine N�he, fingen an, zweideutige Bemerkungen zu machen, die mir die R�te ins Gesicht trieben, aber nicht vor Verlegenheit, sondern vor Scham und Wut gleicherma�en. Ihre Andeutungen wurden direkter, ihre Stimmen fordernder. Ich wies sie zur�ck, immer entschiedener, doch es was als w�rde sie das nicht interessieren. Ihr Gel�chter hallte mir im Kopf nach, ihre Worte brannten sich in mein Ged�chtnis ein.
Was mich noch mehr beunruhigte, war, dass es nicht bei den Jungen blieb. Die �lteren M�nner des Dorfes schienen es besser zu verbergen, aber ich bemerkte ihre Blicke trotzdem. Sie waren subtiler, weniger offensichtlich, aber in manchen Augen lag ein Ausdruck, der mir das Blut in den Adern gefrieren lie�. Ich f�hlte mich wie ein Tier, das in einem K�fig beobachtet wird, jede Bewegung registriert, jedes Zucken interpretiert. Es war erdr�ckend und ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Ich habe mit niemandem dar�ber gesprochen. Nicht mit meiner Mutter, nicht mit den �ltesten. Was h�tte ich auch sagen sollen? Dass ich Angst hatte vor den Blicken, vor den Andeutungen? Dass ich mich immer unwohler f�hlte? Ich wusste, dass mir niemand glauben w�rde. Und dann kam der Moment, in dem sie ihre Zur�ckhaltung endg�ltig ablegten.
Die Ber�hrungen wurden fordernder, ihre Worte direkter. Manche Jungen versuchten sogar, mich in die Enge zu treiben, wenn ich allein war. Ich entkam immer, fand immer einen Weg, mich aus der Situation zu winden, aber es wurde immer schwieriger. Und dann begann das Gerede. Die anderen Dorfbewohner - Frauen, M�nner, selbst die �ltesten- fl�sterten hinter meinem R�cken. Ich h�rte es, wenn ich an ihnen vorbeiging, wie ihre Stimmen abfielen, wie die Worte ?Verf�hrung" und ?Hexerei" laut genug waren, dass ich sie verstehen konnte. Sie sagten, ich h�tte die Jungen des Dorfes verhext, ihre K�pfe verdreht und sogar die M�nner, die alt genug waren, um es besser zu wissen.
Manche behaupteten, es sei ein Fluch, den ich aus dem Walt mitgebracht hatte, als das Baby, das man am Waldrand gefunden hatte. Andere Sprachen davon, dass ich einen Verf�hrungszauber wirken w�rde, wie eine Hexe aus den Geschichten, die sie sich abends am Feuer erz�hlten. Ich h�tte lachen k�nnen, so eine absurde Vorstellung. Aber ich konnte nicht lachen. Die K�lte in ihren Augen, das Unbehagen, das in der Luft lag, war zu greifbar. Ich war keine Hexe, keine Zauberin. Ich war nur ein M�dchen, das nie dazugeh�rte und jetzt langsam zur Zielscheibe wurde.
Der Vollmond steht fast greifbar am Himmel, hell und kalt wie ein einsames Auge, das auf uns alle herabblickt. Die Luft ist erf�llt von der bekannten, stillen Spannung, die jede Vollmondnacht mit sich bringt. Doch diesmal ist sie anders. Schwerer. D�stere Vorahnungen liegen wie ein Schleier �ber dem Dorf, w�hrend die Fensterl�den verrammelt und die T�ren fest verschlossen werden.
Keiner spricht es aus, aber wir f�hlen es alle. Irgendetwas wird passieren.
Ich liege wach in meinem Bett, lausche dem Knarren des alten Holzes, das bei jedem Windsto� leise protestiert. Pl�tzlich durchbrechen Schreie die Stille. Ein durch Mark und Bein gehender Klang, der mein Herz stillstehen l�sst. Ich springe auf, laufe zum Fenster und versuche, etwas durch die schmalen Spalten der Fensterl�den zu erkennen. Doch die Nacht ist undurchdringlich und die Schreie werden von einem abrupten Schweigen abgel�st, das noch be�ngstigender ist.
Am Morgen findet man ihn - den Jungen. Seine leblosen Augen starren in den Himmel, seine H�nde ausgestreckt, als h�tte er versucht, nach etwas zu greifen, das nicht mehr da ist. Er liegt mitten auf dem Weg, der von seinem Haus zu meinem f�hrt, mit aufgerissenem Bauch. Die Menschen haben sich um ihn versammelt, w�hrend der Schock und die Trauer �ber das Dorf hereinbricht wie eine kalte Flut. Ich sp�re ihre Blicke auf mir. Die Tuscheleien werden lauter, die Worte sch�rfer, die Anschuldigungen direkter. Sie brauchen keinen Beweis, sie haben mich. Ich bin die Au�enseiterin, das Mysterium, die Fremde. Jetzt bin ich auch noch die Schuldige f�r sie.
Die Nachricht des Vorfalls verbreitet sich schneller, als ich je f�r m�glich gehalten h�tte. Es dauert nicht lange, bis er kommt. Der Herrscher, der Mann, den wir alle nur aus Geschichten kennen. Manche nennen ihn Verwalter, andere schlicht ?den Herren". Niemand wei�, wie alt er wirklich ist oder wie viele L�ndereien er besitzt. Es wird gesagt, sein Reich sei so gro�, dass er selbst nie ganz wei� wo seine Grenzen verlaufen. Und doch ist er hier, in unserem abgelegenen Dorf, sein langer Schatten f�llt auf uns alle.
Er reitet in einer Prozession, flankiert von M�nnern in dunklen R�stungen, die kein Wort sprechen, aber allein durch ihre Anwesenheit klare Botschaften senden. Sein Pferd ist tiefschwarz, ein Wesen von majest�tischer Sch�nheit, dass die Erde unter seinen Hufen erzittern l�sst. Als er absteigt, h�llt ihn eine unnahbare Aura ein, die die Luft schwer macht. Seine Bewegungen sind ruhig, pr�zise, schnell wie ein Raubtier, das nie unn�tige Kraft verschwendet. Seine Kleidung ist schlicht, aber von so edlem Stoff, dass sie nicht aus dieser Welt zu stammen scheint.
Die Dorfbewohner sind verzweifelt. Sie flehen ihn an, uns zu besch�tzen, vor was auch immer in jener Nacht den Jungen get�tet hat. Sie bieten alles was sie haben im Austausch gegen Schutz an - Korn, Vieh, sogar ihre Ersparnisse. Doch er scheint unger�hrt. Seine dunklen Augen mustern die Menschen vor ihm ohne dass sich ein einziges Gef�hl in seinen Z�gen erkennen l�sst. Dann f�llt das Wort ?Opfer".
Die Menge dreht sich zu mir und pl�tzlich schien es, als w�rde die Welt stillstehen. Ich wei� sofort, was sie vorhaben. Ich bin das naheliegende Ziel, die einfache L�sung. Wenn sie mich opfern, k�nnen sie vielleicht ihre Ruhe zur�ckkaufen - so denken sie sich das jedenfalls. Und vielleicht haben sie ja sogar Recht. Doch anstatt mich vor Angst zu winden, habe ich das Gef�hl, dass etwas anderes in mir aufsteigt. Etwas Wildes, unbez�hmbares. Trotz. Stolz. ?Kate, sie wird unser Opfer sein. Kate ist unser Opfer an dich, oh Herr.", ert�nt die Stimme eines Mannes. Ich wei�, dass ich keine Wahl habe, dass mein Leben hier l�ngst vorbei ist. Wenn ich bleibe werde ich auf dem Scheiterhaufen enden, oder von den Blicken und H�nden der M�nner erdr�ckt. Ich habe nichts zu verlieren. Also richte ich mich auf, hebe mein Kinn und lasse keinen Funken Unsicherheit in meinen Augen aufblitzen. ?Gut", sage ich k�hl. ?Dann bin ich das
Opfer dieses Dorfes. Aber nicht, weil ihr es wollt. Sondern weil ich es w�hle."
Die Menge verstummt. Niemand hat mit meinen Worten gerechnet. Ohne zu z�gern gehe ich auf ihn zu, den Herren, der �ber mein Schicksal entscheiden wird. Seine Augen liegen auf mir, dunkel und durchdringend, als k�nnten sie bis auf den Grund meiner Seele blicken. Ich f�hle die K�lte, die von ihm ausgeht, aber auch die seltsame Macht, die ihn umgibt. Niemand versucht mich aufzuhalten. Die Dorfbewohner haben Angst, dass ich mich umentscheiden k�nnte. Doch das tue ich nicht.
Ich trete direkt vor ihn, halte seinem Blick stand, auch wenn mein Herz wie wild schl�gt. Ich wei�, dass meine Haltung das Einzige ist, was mir jetzt noch bleibt. Er sieht mich an, schweigend, forschend und absch�tzend. Dann hebt er seine Hand.
Es ist das erste Mal, dass mich jemand ber�hrt, seit die Entscheidung gefallen ist, dass ich sein Opfer sein soll. Seine Finger greifen leicht, aber bestimmt nach meinem Kinn und heben es an, so dass ich ihm direkt in die Augen schaue. Sein Blick ist kalt, fast wie der Mond selbst, aber es liegt auch etwas darin, was ich nicht deuten kann. Er studiert mein Gesicht, als w�rde er nach etwas suchen. Mein Stolz verbot es mir, auch nur zu blinzeln. Ich halte seinem Blick stand, trotzig und unbeugsam.
?Ein interessantes Opfer", entscheidet er, seine Stimme tief und unnahbar.
Dann l�sst er mich los und ich sp�re die Stellen an meinem Kinn, wo seine Finger grade noch gewesen sind, als h�tte er ein Zeichen hinterlassen. ?Sind sie zufrieden mit meinem Opfer?", ergreife ich das Wort und bemerke, wie einige Dorfbewohner sichtlich zusammenzucken bei meinen Worten.
Offenbar hatte das Opfer ihn nicht direkt anzusprechen.
?Oh ja.", ert�nt seine zufriedene Stimme und ich gehe mit erhobenen Haupt zu
den Wachen, die er mit einem Handzeichen heranwinkt.